"Der Erfolg war kein Zufall"

Prof. Dr. Marcus Altfeld
© HPI / Gisela Köhler Fotodesign
Aus immunologischer Sicht hat die Pandemie gezeigt: Es braucht breit aufgestellte und geförderte Grundlagen-forschung – und eine robuste Brücke zur Anwendung. Im Gespräch mit Marcus Altfeld, Mitglied der interdisziplinären DFG-Kommission für Pandemieforschung.
Interview: Dr. Rembert Unterstell, “forschung”.
Professor Dr. med. Marcus Altfeld ist seit 2017 Professor für Immunologie und Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE). Am Hamburger Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie leitet er seit 2013 eine Abteilung, die die menschlichen Immunantworten zum Schutz gegen Viren erforscht.
"forschung": Herr Professor Altfeld, wir führen dieses Interview Anfang Oktober. Auf der einen Seite fällt hier und dort die Maskenpflicht und stagniert die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, auf der anderen Seite befürchten Virologen einen „fulminanten Verlauf“ der vierten Coronawelle in Herbst und Winter. Gehören auch Sie zu den Warnern?
Marcus Altfeld: Ich mache mir aus mehreren Gründen Sorgen. Das eine ist die gegenwärtige Coronawelle, die regional sehr unterschiedlich verläuft und von der wir noch nicht wissen, ob es eine begrenzte vierte oder die erste Welle ist, die uns in die Winterwelle hineinbringt. Zugleich sind noch viele, viele Menschen nicht geimpft. Ich sehe auch eine Influenzawelle auf uns zukommen, sodass es mehrere Infektionswellen im Winter geben könnte. Wir müssen wachsam bleiben und weiterhin bereit sein, die Pandemie-Schutzmaßnahmen anzupassen.
Alle Experten unterstreichen, dass die Immunität der Bevölkerung der beste Schutz vor einer unkontrollierbaren Infektionsdynamik ist. Ist eine Herdenimmunität überhaupt noch erreichbar?
Es ist etwas traurig zu sehen, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in der Bevölkerung abgenommen hat beziehungsweise jetzt stagniert. Die Frage ist, wie man Ungeimpfte ermutigen kann, sich doch noch impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen, aber auch die Kinder, die noch keinen Zugang zu Impfungen haben. Vor dem Winter sieht es nicht danach aus, dass die Herdenimmunität noch erreicht werden könnte.
Mit der dritten, der sogenannten Auffrischungsimpfung, wird in den Bundesländern, aber auch im Ausland, sehr unterschiedlich umgegangen. Wer braucht aus Ihrer immunologischen Sicht die dritte Spritze?
Ich würde da eine immunologische Sichtweise von einer ethischen Antwort unterscheiden. Neue Daten zeigen eindeutig, dass die immunologische Wirksamkeit der mRNAWirkstoffe über die Zeit nachlässt und der Schutz gegen eine Infektion abnimmt, und zwar in allen Altersgruppen. Der Schutz vor einem schweren Verlauf mit Krankenhausbehandlung bleibt anscheinend zunächst erhalten, insbesondere bei Jüngeren. Es ist daher aus meiner Einschätzung für die über 60-Jährigen immunologisch sinnvoll, fünf bis sechs Monate nach der zweiten Impfung eine dritte Impfung zu erhalten; das Gleiche gilt für immungeschwächte und vorerkrankte Menschen.
Auf der anderen Seite würde eine weitere, dritte Massenimpfung in Europa, Israel und Nordamerika die Impffortschritte in Afrika und Asien weiter verzögern. Das ist ein großes ethisches Problem. Viele haben dort nicht einmal eine erste Impfung bekommen. Die Pandemie könnte sich dort unkontrolliert weiter ausbreiten, auch neue, noch gefährlichere Virusvarianten könnten entstehen.
Aus Ihrer Expertise als experimenteller Immunologe heraus weisen Sie darauf hin, dass COVID-19-Infektionen bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen – Männer haben ein weitaus größeres Risiko, auf der Intensivstation zu landen, ja sogar an COVID-19 zu sterben als Frauen. Was ist der evidenzbasierte Befund?
Die Beobachtung, dass bei Männern die Hospitalisierungsrate höher und auch das Sterberisiko größer ist, basiert auf Vergleichsdaten, greifbar auf der Plattform Global Health 50/50, die seit einigen Jahren versucht, geschlechtsspezifische Verläufe von Krankheiten zu dokumentieren. Von Land zu Land variierend, aber mit gleichem epidemiologischen Trend: Männer erkranken häufiger schwer an COVID-19. Der Faktor liegt zwischen 1,3 und 1,7.
Worauf gründen die geschlechtsspezifischen Verläufe?
Unterschiedliche Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen kennen wir aus der HIV-Erkrankung, aus der Influenza und anderen Infektionskrankheiten. Zur Erklärung gilt es drei Faktoren zu unterscheiden: die Unterschiede im Verhalten zwischen den Geschlechtern, die Rolle der Sexualhormone und die der Gene auf den X-Chromosomen. Sehr vereinfachend gesprochen ist biologisch bekannt, dass Testosteron das Immunsystem und die Immunantwort eher schwächt, während Östrogen die Immunantwort fördert. Klinisch zeigt sich das bei Autoimmunkrankheiten, etwa Multiple Sklerose, die weitaus häufiger bei Frauen als Männern auftreten. Das Immunsystem von Frauen kann virale Infektionskrankheiten, darunter auch SARS-CoV-2, besser kontrollieren. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die Gene, die auf den X-Chromosomen liegen. Frauen haben bekanntlich zwei X-Chromosomen, Männer eins. Das übersetzt sich über spezielle Immunrezeptoren in die Fähigkeit, auf RNA-Viren mit Type-I-Interferonen zu antworten und die Infektion schneller zu kontrollieren.
Diese Zusammenhänge werden wahrscheinlich auch Gegenstand der 2021 eingerichteten und von Ihnen koordinierten Forschungsgruppe „Geschlechtsspezifische Unterschiede in Immunantworten“ sein?
Wir möchten in der Tat die molekularen Mechanismen untersuchen und verstehen, warum sich die Immunantworten bei Frauen und Männern unterscheiden. Die einzelnen Arbeitsgruppen untersuchen verschiedene Systeme wie Autoimmunerkrankungen, Infektionskrankheiten oder Impfantworten. Die grundlegende Hypothese ist, dass es in diesen unterschiedlichen Erkrankungen dieselben molekularen Mechanismen sind, die für die geschlechtsspezifischen Krankheitsverläufe verantwortlich sind. Der steuernde Einfluss der Sexualhormone und die Rolle der Gene auf dem X-Chromosom werden systematisch in allen Systemen untersucht.
Was ist das Neue an den geplanten Forschungsarbeiten?
Die unterschiedlichen Krankheitsverläufe bei Frauen und Männern sind in der Vergangenheit viel beschrieben worden – aber die grundlegenden Mechanismen dafür sind nicht verstanden. Die müssen wir auf molekularer Ebene verstehen, um über das Verständnis der Signalwege und -kaskaden im Immunsystem neue Therapieansätze entwickeln zu können.
Mitte November werden alle von der DFG-Geförderten mit der DFG-Kommission für Pandemieforschung zusammenkommen – Sie gehören zum wissenschaftlichen Vorbereitungsteam –, um bisherige Forschungsbilanzen zu diskutieren, aber auch auf Forschungsbedarfe zu schauen. Ohne der Konferenz etwas vorwegnehmen zu wollen: Wo liegt exemplarisch aus der Sicht Ihres Faches der vorrangige Forschungsbedarf?
Im Bereich der Immunologie geht es darum, besser zu verstehen, was die protektiven Immunantworten gegen SARS-CoV-2 ausmacht. Wie kann das immunologische Verständnis dazu beitragen, dass Impfstoffe breite, lang anhaltende Antikörperantworten induzieren können und der Schutz nicht nach fünf, sechs Monaten wieder abzusinken beginnt. Der andere, auch gesellschaftlich wichtige Bereich ist Long Covid. Dabei fehlt ein gutes Verständnis dafür, welche Rolle das Immunsystem bei diesem Syndrom spielt. Hier können wir noch sehr viel lernen.
Viel wird über Lehren aus der Pandemiebewältigung gesprochen und noch mehr über „Preparedness“. Worauf wird es ankommen?
Preparedness heißt für mich, vorbereitet auf etwas zu sein, das man noch nicht kennt oder kennen kann. Das ist die Herausforderung. Wir haben in dieser Pandemie gesehen, dass innerhalb kürzester Zeit hochwirksame Impfstoffe auf Grundlage der mRNA-Technologie gefunden wurden. Diese Erfolge waren nur möglich, weil es über Jahrzehnte zuvor mRNA-bezogene Grundlagenforschung gab. Der Erfolg war kein Zufall, und er zeigt als Beispiel, wie extrem wichtig es ist, Grundlagenforschung breit aufzustellen und zu fördern. Die Brücke zwischen Grundlagenforschern und Anwendern muss noch breiter und robuster werden, das gehört für mich zur Preparedness.
Wenn man über die medizinisch-grundlagengestützte Preparedness hinausblickt: Die WHO hat, unterstützt von der Bundesregierung, Anfang Oktober in Berlin einen „Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence“ eröffnet, der helfen soll, schneller auf neue Erreger zu reagieren. Kann das ein Element von Preparedness sein?
Kommunikation und Kommunikationsstrukturen sind sicher ein ganz wichtiger Faktor. Je schneller der Austausch auch auf internationaler Ebene verläuft, Informationen fließen und Daten ausgetauscht werden – umso besser. Das hat diese Pandemie gezeigt. Die Initiative der deutschen Politik und der WHO, einen Kommunikationshub zu etablieren, begrüße ich. Es ist ein Aspekt der Preparedness.
Man sollte im Rückblick auf eineinhalb Jahre Pandemie allerdings nicht vergessen: Die Pandemieerfahrung war für alle neu, manche wissenschaftlichen Einschätzungen und Vorhersagen, die öffentlich kommuniziert wurden, haben sich als falsch oder revisionsbedürftig herausgestellt. Dabei ließ sich vieles gar nicht vorhersagen, dass zum Beispiel die Delta-Variante kam und so viel infektiöser war, dass Impfdurchbrüche schneller kamen als erwartet. Wir haben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur fachbezogen während der Pandemie viel gelernt, viele haben auch in ihrer Kommunikation mit und durch die Medien viel gelernt.
Vielen Dank für das Gespräch!
Weitere Informationen
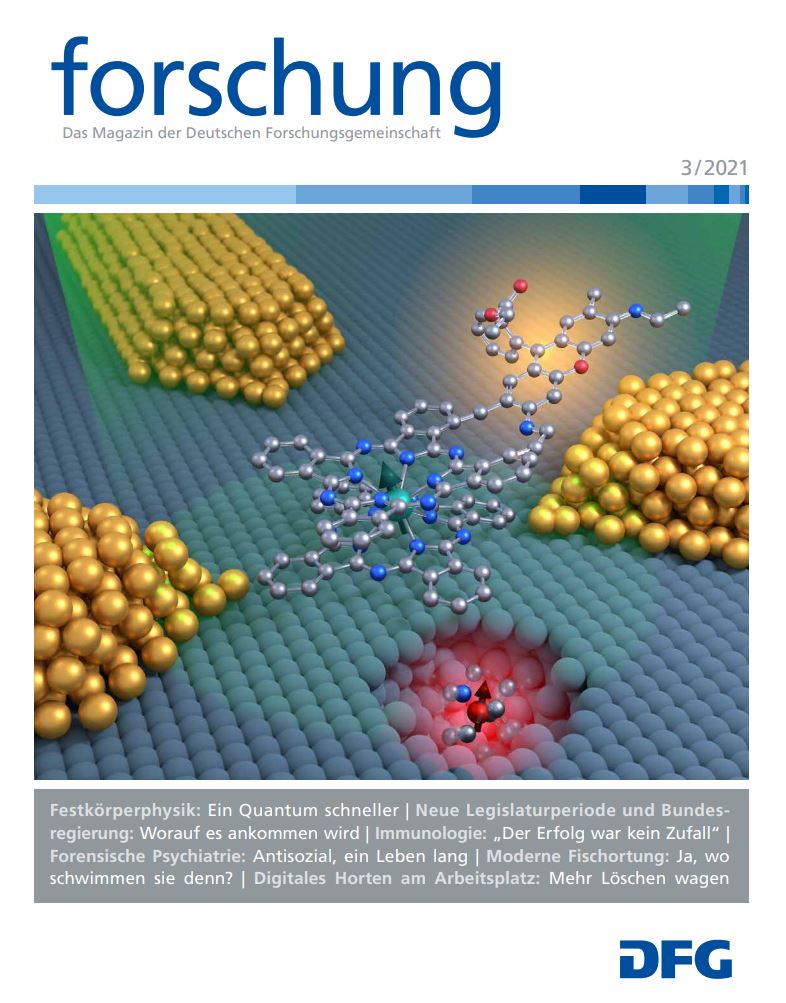
Das Interview ist auch im
erschienen.