DFG fördert vier neue Forschungsgruppen
Themen reichen von Sicherheit in Krisenzeiten bis hin zu personalisierten Therapieansätzen bei Darmkrebs / Insgesamt rund 20,5 Millionen Euro für erste Förderperiode
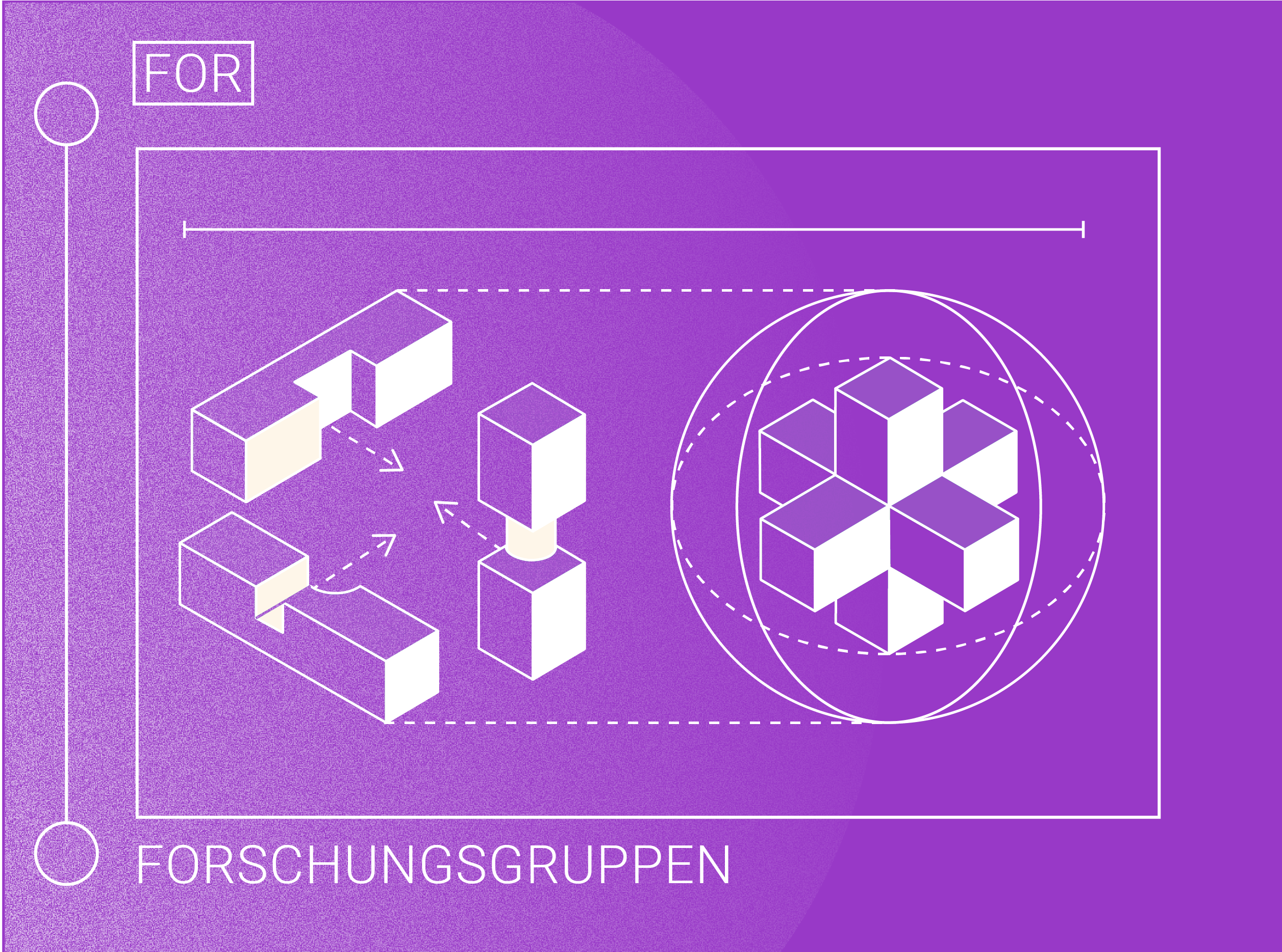
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet vier neue Forschungsgruppen ein. Das hat der Hauptausschuss der DFG auf Empfehlung des Senats beschlossen. Die neuen Forschungsgruppen erhalten insgesamt rund 20,5 Millionen Euro inklusive einer Programmpauschale in Höhe von 22 Prozent für indirekte Projektausgaben. Zusätzlich zu den vier Neueinrichtungen wurde die Verlängerung von zehn Forschungsgruppen und einer Klinischen Forschungsgruppe für eine weitere Förderperiode beschlossen. Eine der neu eingerichteten Forschungsgruppen wird im Rahmen der D-A-CH-Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördert.
Forschungsgruppen ermöglichen Wissenschaftler*innen, sich aktuellen und drängenden Fragen ihrer Fachgebiete zu widmen und innovative Arbeitsrichtungen zu etablieren. Sie werden bis zu acht Jahre lang gefördert. Im Ganzen fördert die DFG zurzeit 188 Forschungsgruppen, zehn Klinische Forschungsgruppen und 17 Kolleg-Forschungsgruppen. Klinische Forschungsgruppen sind zusätzlich durch die enge Verknüpfung von wissenschaftlicher und klinischer Arbeit charakterisiert, während Kolleg-Forschungsgruppen speziell auf geistes- und sozialwissenschaftliche Arbeitsformen zugeschnitten sind.
Die neuen Verbünde im Einzelnen
(in alphabetischer Reihenfolge der Hochschulen der Sprecher*innen):
Bilingualismus bezeichnet die Fähigkeit, in mehr als einer Sprache zu kommunizieren. Dabei stehen die Sprecher*innen vor der Herausforderung, die Zielsprache dem Kontext angemessen auszuwählen und gleichzeitig zu verhindern, dass sie Strukturen anderer gesprochener Sprachen auf die Kommunikationssituation übertragen. Die Forschungsgruppe „Bilinguale Flexibilität – Die Psychologie der Sprachkontrolle“ zielt darauf ab, das Konzept der „Sprachbalance“ zu nutzen, um die Flexibilität des bilingualen Sprachgebrauchs in verschiedenen Kontexten zu untersuchen und besser zu verstehen. Grundgedanke hierbei ist, dass bestimmte kognitive Mechanismen der Sprachkontrolle einer bilingualen Person wesentlich zur Stabilisierung einer auf Kontext und Situation basierenden Sprachbalance beitragen. (Sprecherin: Professorin Anna Katharina Kuhlen, Ph.D., RWTH Aachen)
Was bedeutet Sicherheit in Zeiten zunehmender Krisen, Katastrophen und Verluste? Die Forschungsgruppe „Das Sicherheitsversprechen in katastrophischen Zeiten“ geht dieser Frage interdisziplinär und kollaborativ nach. Ausgangspunkt ist die Untersuchung der aktuellen weltweiten Krise von Frieden und Sicherheit, in deren Folge zentrale Gewissheiten über die Schutzfunktionen demokratischer Regierungsformen und multilateraler Institutionen, die jahrzehntelang als selbstverständlich galten, erodieren. Dabei untersucht die Forschungsgruppe staatliche und gesellschaftliche Reaktionen auf drei eng miteinander verflochtene und sich gegenseitig verstärkende Krisendimensionen: die Zunahme von Kriegen und globalen Konflikten, den weltweiten Trend zur Autokratisierung und die ökologische Krise. (Sprecherin: Professorin Dr. Ursula Schröder, Universität Hamburg)
Darmkrebs macht etwa zehn Prozent aller Krebserkrankungen aus und ist weltweit die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. Von der genombasierten Präzisionsmedizin, bei der die Behandlung an die spezifischen molekularen Veränderungen im Tumor angepasst ist, erhoffte man sich eine Verbesserung der Heilungschancen. Bisher konnten jedoch nur bei einem kleinen Teil der Patient*innen personalisierte Therapien auf Basis von DNA-Sequenzierungen identifiziert werden. Ziel der Forschungsgruppe „Funktionelle Genomik und Mikrobiomik in der Präzisionsmedizin des kolorektalen Karzinoms“ ist es, das komplexe Zusammenspiel zwischen dem Darmmikrobiom, tumorassoziierten Genen und (zielgerichteten) Medikamenten bei der Behandlung von Darmkrebs zu untersuchen und dabei personalisierte Therapieansätze zu entwickeln. Die Forschungsgruppe wird im Rahmen der D-A-CH-Zusammenarbeit mit dem SNF gefördert. (Sprecher: Professor Dr. Matthias Ebert, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg)
Vom 12. bis zum 14. Jahrhundert verwandelten die Bewohner Nordfrieslands den Naturraum durch einschneidende Eingriffe in eine hochproduktive, aber auch sensible Kulturlandschaft. Extremereignisse wie Sturmfluten verwandelten Großteile danach wieder zu Wattflächen. Die Forschungsgruppe „Von Aufstieg und Untergang – Integrative Forschung zur Kulturlandschaftsentwicklung in der nordfriesischen Wattenmeerregion während der letzten zwei Jahrtausende“ zielt auf die raumzeitliche Rekonstruktion dieser mittelalterlichen Küstenlandschaft als Ganzes. Sie will die vielfältigen Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen erfassen, die Bemühungen um Ressourcensicherung, Siedlungsexpansion sowie den Kampf gegen Landverluste verstehen und so auch ein besseres Verständnis des kulturellen Erbes der Region erlangen. (Sprecherin: Dr. Hanna Hadler, Universität Mainz)
Die für eine weitere Förderperiode verlängerten Verbünde
(in alphabetischer Reihenfolge der Hochschulen der Sprecher*innen und mit Verweisen auf die Projektbeschreibungen in der DFG-Internetdatenbank GEPRIS zur laufenden Förderung):
- Forschungsgruppe Proximity induzierte Korrelationseffekte in niedrigdimensionalen Strukture(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Christoph Tegenkamp, TU Chemnitz)
- Forschungsgruppe Reassemblierung von Interaktionsnetzwerken zwischen Arten – Resistenz, Resilienz und funktionale Regeneration eines Regenwalde(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Nico Blüthgen, Universität Darmstadt)
- Forschungsgruppe Erstarrungsrisse beim Laserstrahlschweißen: Hochleistungsrechnen für Hochleistungsprozess(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Michael Schmidt, Universität Erlangen-Nürnberg)
- Forschungsgruppe Rekonfiguration und Internalisierung von Sozialstruktur (RISS(externer Link) (Sprecherin: Professorin Dr. Daniela Grunow, Universität Frankfurt am Main)
- Forschungsgruppe Reduktion der Komplexität von Nichtgleichgewichtssysteme(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Gerhard Stock, Universität Freiburg)
- Forschungsgruppe Innovation und Koevolution in der sexuellen Reproduktion von Pflanzen – ICIP(externer Link) (Sprecherin: Professorin Dr. Annette Becker, Universität Gießen)
- Forschungsgruppe Geistliche Intermedialität in der Frühen Neuzei(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Johann Anselm Steiger, Universität Hamburg)
- Klinische Forschungsgruppe CATCH ALL – Heilungsperspektive für alle Erwachsenen und Kinder mit Akuter Lymphoblastischer Leukämie (ALL(externer Link) (Sprecherin: Professorin Dr. Claudia Baldus, Universität Kiel; Projektleiter: Professor Dr. Matthias Peipp, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein)
- Forschungsgruppe Zyklische Optimierun(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Jochen Trommer, Universität Leipzig)
- Forschungsgruppe Energielandschaften und Struktur in ionenleitenden Feststoffen (ELSICS(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Karl-Michael Weitzel, Universität Marburg)
- Forschungsgruppe Räumliche Ökologie von Lebensgemeinschaften in hochdynamischen Landschaften: von der Inselbiogeographie zu Meta-Ökosystemen (DynaCom(externer Link) (Sprecher: Professor Dr. Helmut Hillebrand, Universität Oldenburg)
Weiterführende Informationen
Ausführliche Informationen erteilen auch die Sprecher*innen der Verbünde.
Zu den Forschungsgruppen der DFG:
| E-Mail: | presse@dfg.de |
| Telefon: | +49 228 885-2109 |
| E-Mail: | julie.martin@dfg.de |
| Telefon: | +49 (228) 885-2577 |