DFG fördert sieben neue Forschungsgruppen
Themen reichen von Sozial-Ökologie in Ballungszentren bis zu neuronalen Grundlagen der Kommunikation von Wirbeltieren / Insgesamt rund 33 Millionen Euro für erste Förderperiode
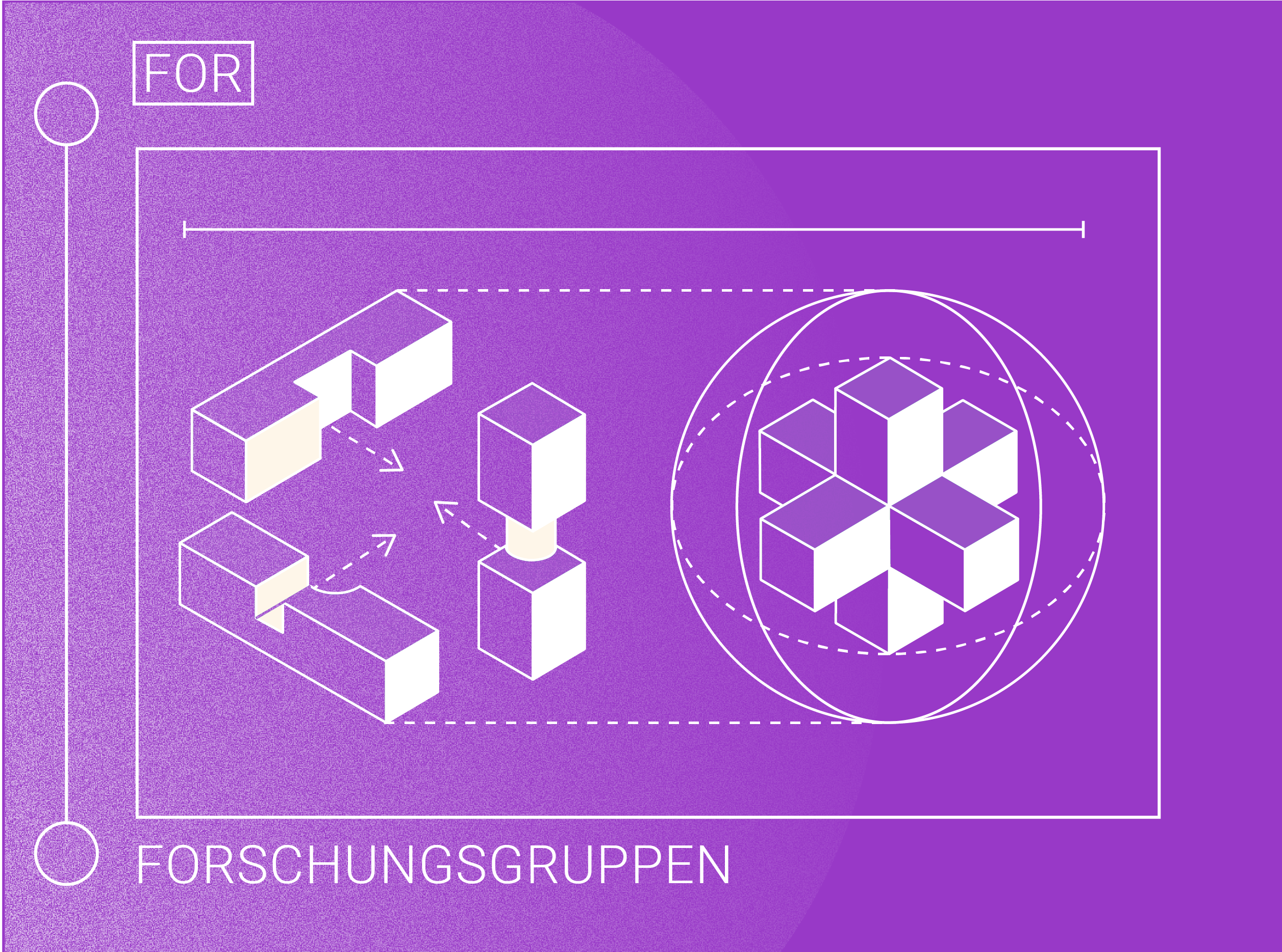
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet sieben neue Forschungsgruppen ein. Das hat der Hauptausschuss der DFG auf Empfehlung des Senats beschlossen. Die neuen Forschungsgruppen erhalten insgesamt rund 33 Millionen Euro inklusive einer Programmpauschale in Höhe von 22 Prozent für indirekte Projektausgaben. Zusätzlich zu den sieben Neueinrichtungen wurde die Verlängerung von drei Forschungsgruppen für eine weitere Förderperiode beschlossen.
Forschungsgruppen ermöglichen Wissenschaftler*innen, sich aktuellen und drängenden Fragen ihrer Fachgebiete zu widmen und innovative Arbeitsrichtungen zu etablieren. Sie werden bis zu acht Jahre lang gefördert. Im Ganzen fördert die DFG zurzeit 188 Forschungsgruppen, zehn Klinische Forschungsgruppen und 17 Kolleg-Forschungsgruppen. Klinische Forschungsgruppen sind zusätzlich durch die enge Verknüpfung von wissenschaftlicher und klinischer Arbeit charakterisiert, während Kolleg-Forschungsgruppen speziell auf geistes- und sozialwissenschaftliche Arbeitsformen zugeschnitten sind.
Die neuen Verbünde im Einzelnen
(in alphabetischer Reihenfolge der Hochschulen der Sprecher*innen)
Infrastrukturen gewährleisten die Versorgung von Leben, erzeugen aber auch komplexe soziokulturelle Abhängigkeitsgeflechte. Die aus Vertreter*innen der Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und politischen Philosophie bestehende Forschungsgruppe „Infrastruktur: Ästhetik und Versorgung“ fragt nach den Formen dieser Abhängigkeiten und nach alternativen infrastrukturierenden Praktiken. Die Wissenschaftler*innen blicken auch auf ästhetische Kriterien – diese schaffen den Möglichkeitsraum dafür, was als Infrastruktur wünschbar und machbar erscheint und beeinflussen so das Zusammenleben. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf Infrastrukturen ab 1900 bis heute, die vor allem durch den Abbau von Rohstoffen, zum Beispiel im Bergbau, und durch Deindustrialisierung geprägt sind. (Sprecher: Professor Dr. Jörn Etzold, Universität Bochum)
Sogenannte Stimulus-responsive lumineszierende Koordinationsverbindungen (STIL-COCOs) sind Verbindungen, deren Eigenschaften wie Farbe oder Leuchtkraft durch externe Reize – zum Beispiel Druck – geändert werden können. Sie sind deshalb von großem Interesse für die Entwicklung photonischer Anwendungen wie Fälschungsschutzmethoden, Datenspeicherung und Quantenkommunikation. Um eine bestimmte Eigenschaftsänderung als Reaktion auf einen bestimmten Stimulus zu erreichen, gibt es jedoch bisher keine überzeugenden Designstrategien. Die Forschungsgruppe „Stimulus-responsive lumineszierende Koordinationsverbindungen –STIL-COCOs“ will Struktur-Eigenschafts-Beziehungen für effiziente STIL-COCOs herstellen, um so den Weg für neue technologische Plattformen zu ebnen. (Sprecher: Professor Dr. Andreas Steffen, TU Dortmund)
Veränderungen in der Umwelt wie die Bedrohung durch Raubtiere oder Hitze erfordern eine ständige Anpassung des physiologischen Zustands und des Verhaltens von Organismen. Sensorische Reaktionen darauf erfolgen zumeist durch das Zusammenspiel von autonomem und zentralem Nervensystem – und führen etwa zu der Anpassung von Herzleistung und Aufmerksamkeit. Dabei werden die adaptiven Prozesse durch wenige Botenstoffe vermittelt, die auf eine große Anzahl G-Protein-gekoppelter Rezeptoren (GPCRs) in der Zelle wirken. Ziel der Forschungsgruppe „Dynamische Integration von GPCR-Signalwegen zur Steuerung von Organfunktion und Tierverhalten“ ist es, die grundlegenden Prinzipien der GPCR-Signalübertragung in verschiedenen Tiermodellen zu erforschen, um die Muster der Steuerung von Anpassungsprozessen zu verstehen. (Sprecher: Professor Dr. Jörn Simon Wiegert, Universität Heidelberg)
Viele altersbedingte neurodegenerative Krankheiten entstehen, weil falsch gefaltete Proteine Aggregate oder Fibrillen ausbilden – oder sich in biomolekularen Kondensaten, also membranlosen zellulären Strukturen aus Makromolekülen, zusammenlagern. Seit Kurzem ist bekannt, dass hierbei sogenannte molekulare Chaperone eine Schlüsselrolle spielen – Proteine, die andere Proteine bei der korrekten Faltung, dem Transport und der Stabilität unterstützen. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind jedoch noch unklar. Hier setzt die Forschungsgruppe „Chaperon-vermittelte Regulation von krankheitsverursachenden amyloiden Proteinkonformationen in biomolekularen Kondensaten“ an. Die Wissenschaftler*innen wollen verstehen, wie Chaperone kondensatbildende Proteine regulieren und wie die Faltung dieser Proteine damit zusammenhängt. (Sprecherin: Professorin Dr. Janine Kirstein, Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI), Jena)
Stadtgrenzen markieren eine etwas willkürliche Trennung zwischen einem (urbanen) Innenraum unter starker menschlicher Kontrolle und einem (ruralen) Äußeren, das stärker durch natürliche, biophysikalische Prozesse bestimmt ist. In der Realität sind aber beide Räume seit jeher eng miteinander verknüpft und werden mit der immer intensiveren Nutzung natürlicher Ressourcen zunehmend durch rural-urbane Transformationsprozesse geprägt, in besonderer Weise in vielen Regionen des Globalen Südens. Die sozial-ökologisch ausgerichtete Forschungsgruppe „Nachhaltige Rurbanität – Ressourcen, Gesellschaft und Regulierungssysteme“ befasst sich anhand von Ballungsgebieten Indiens, Ghanas und Marokkos mit diesem Phänomen. So sollen Wirkmechanismen, Folgen und Steuerungsprozesse von Rurbanität beispielhaft untersucht werden. (Sprecher: Professor Dr. Andreas Bürkert, Universität Kassel)
Soziale Interaktionen zwischen Tieren basieren oft auf dem Austausch von Lauten, die für Überleben und Fortpflanzung unerlässlich sind. Unser Verständnis der grundlegenden neuronalen Mechanismen, die die Produktion, das Erlernen und die Koordination von Lautäußerungen zwischen Individuen bei Wirbeltieren steuern, ist jedoch noch sehr begrenzt. Die Forschungsgruppe „Neuronale Grundlagen vokaler Kommunikation“ rückt deshalb jene Gehirnnetzwerke in den Fokus, die die Lautäußerungen bei Fischen, Vögeln und Säugetieren beeinflussen. Zudem will der Verbund gemeinsame Prinzipien identifizieren, die der Funktionsweise verschiedener vokaler Kommunikationssysteme bei Wirbeltieren zugrunde liegen – und artspezifische Anpassungen aufdecken, die durch ökologische und soziale Rahmenbedingungen geprägt sind. (Sprecher: Professor Dr. Steffen Hage, Universität Tübingen)
Die Forschungsgruppe „Asset Allocation und Asset Pricing in regulierten Märkten und Institutionen“ nimmt die bedeutenden Auswirkungen von Risiko und Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung auf den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft in den Blick. Im Zentrum der Forschung steht vor allem die Frage, wie sich diese Unsicherheit und das Risikobewusstsein auf die Vermögensallokation und die Preisbildung von Vermögenswerten in regulierten Märkten auswirken. Hierzu sollen nicht nur neuartige quantitative Modelle für regulatorische Unsicherheit entwickelt, sondern auch Messgrößen zur Bewertung dieser Faktoren abgeleitet sowie die mit regulatorischer Unsicherheit verbundenen Auswirkungen auf Märkte und relevante Institutionen analysiert werden. (Sprecherin: Professorin Dr. An Chen, Universität Ulm)
Die für eine weitere Förderperiode verlängerten Verbünde
(in alphabetischer Reihenfolge der Hochschulen der Sprecher*innen und mit Verweisen auf die Projektbeschreibungen in der DFG-Internetdatenbank GEPRIS zur laufenden Förderung)
- Forschungsgruppe „ImmunoChick – Analyse der aviären Immunantwort im Kontext von Infektionen“ (Sprecher: Professor Benedikt Bertold Kaufer, Ph.D., FU Berlin), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/43452463(externer Link)
- Forschungsgruppe „Disrupt – Evade – Exploit: Steuerung der Genexpression und Wirtsantwort durch DNA Viren (DEEP-DV)“ (Sprecherin: Professorin Dr. Nicole Brigitte Fischer, Universität Hamburg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/44364489(externer Link)
- Forschungsgruppe „Dynamik des tiefen Untergrundes von Hochenergiestränden (DynaDeep)“ (Sprecherin: Professorin Dr. Gudrun Massmann, Universität Oldenburg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/43149150(externer Link)
Weiterführende Informationen
Ausführliche Informationen erteilen auch die Sprecher*innen der Verbünde.
| E-Mail: | presse@dfg.de |
| Telefon: | +49 228 885-2109 |
| E-Mail: | julie.martin@dfg.de |
| Telefon: | +49 (228) 885-2577 |