DFG fördert neun neue Sonderforschungsbereiche
Themen reichen von pilzbasierten Baumaterialien über Autoimmunkrankheiten bis zu molekularer Bor-Chemie / 120 Millionen Euro Fördermittel für erste Förderperiode
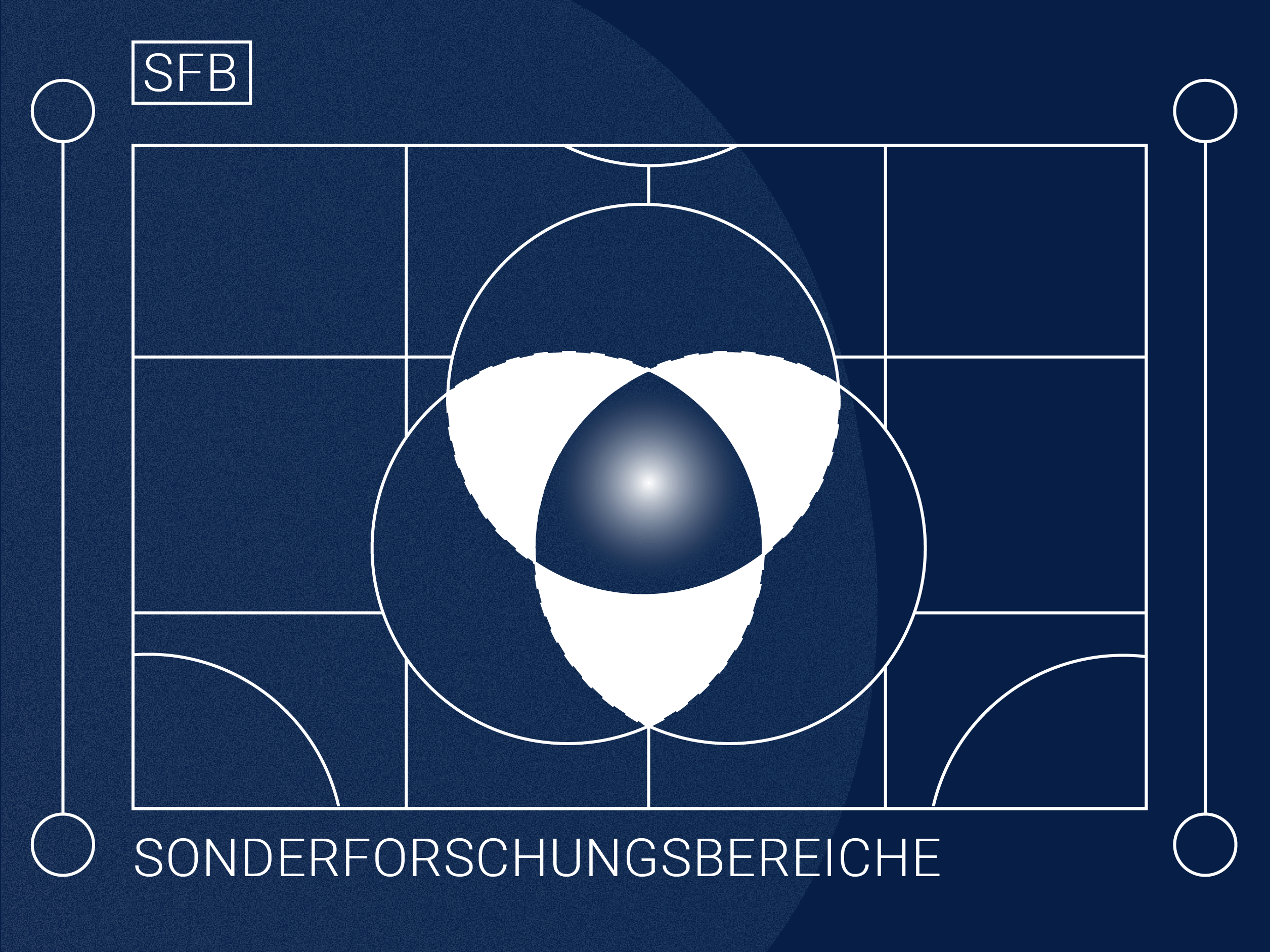
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet zur weiteren Stärkung der Spitzenforschung an den Hochschulen neun neue Sonderforschungsbereiche (SFB) ein. Dies hat der zuständige Bewilligungsausschuss in Bonn beschlossen. Die neuen Verbünde werden ab April 2026 zunächst für drei Jahre und neun Monate mit insgesamt rund 120 Millionen Euro gefördert. Darin enthalten ist eine Programmpauschale in Höhe von 22 Prozent für indirekte Projektausgaben. Einer der neuen Verbünde ist ein SFB/Transregio (TRR), der von mehreren antragstellenden Hochschulen gemeinsam getragen wird.
Zusätzlich zu den neun Einrichtungen stimmte der Bewilligungsausschuss für die Verlängerung von 32 Sonderforschungsbereichen um je eine weitere Förderperiode, darunter 15 SFB/Transregio. Sonderforschungsbereiche ermöglichen die Bearbeitung innovativer, anspruchsvoller und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben im Verbund und sollen damit der Schwerpunkt- und Strukturbildung an den antragstellenden Hochschulen dienen; sie werden maximal zwölf Jahre gefördert. Insgesamt fördert die DFG ab April 2026 damit 257 Verbünde.
Für zwei bereits in der Förderung befindliche SFB hat der Bewilligungsausschuss zudem je sechs Transferprojekte bewilligt.
Die neuen Sonderforschungsbereiche im Einzelnen
(in alphabetischer Reihenfolge ihrer Sprecherhochschulen und unter Nennung der Sprecher*innen sowie der weiteren antragstellenden Hochschulen):
Werden in Zukunft Baumaterialien und Möbel auf der Basis von Pilzen hergestellt? Der SFB „MY-CO BUILD: Biotechnologische Herstellung, Charakterisierung und Nachhaltigkeitsbewertung pilzbasierter Baumaterialien“ will für diese Zukunftsvision eine neue Klasse pilzbasierter Materialien entwickeln, die biologisch hergestellt und biologisch abbaubar sind. Für die Erforschung und Entwicklung dieser Materialien soll die Pilzbiotechnologie genutzt werden. Dazu will der Verbund die biologischen, mechanischen, physikalischen, chemischen, thermischen, akustischen und architektonischen Eigenschaftsprofile pilzbasierter Materialien in Wechselwirkung mit dem genetischen Potenzial des verwendeten Pilzorganismus untersuchen. (TU Berlin, Sprecherin: Professorin Dr.-Ing. Vera Meyer)
Autoimmunerkrankungen und chronisch entzündliche Erkrankungen sind Krankheitsbilder, für die es derzeit keine anhaltende Heilung gibt. Ihre Behandlung ist teuer, erfordert großen Aufwand und ist für Patient*innen zumeist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Der SFB „CASCAID – Zelluläre und systemische Kontrolle von Autoimmunkrankheiten“ will die Mechanismen verstehen, die chronischen Entzündungen und Therapieresistenzen zugrunde liegen. Dabei fokussiert sich der Verbund vor allem auf Immunzellen und deren Interaktionen in den betroffenen Geweben. Über die gezielte Einbindung von Analysen an Patientengewebe sollen letztlich Schritte dahin unternommen werden, derzeit gängige Therapieformen, die lebenslange Immunsuppression mit sich bringen und mit weiteren medizinischen Komplikationen verbunden sind, durch neuartige Behandlungsformen abzulösen. (Universität Erlangen-Nürnberg, Sprecher: Professor Dr. Georg Schett)
Wie kann das Bildungssystem für Kinder und Jugendliche gerechter gestaltet werden? Und wie können Inklusion und Anerkennung in Bildungsprozessen besser umgesetzt werden? Aktuell fehlt ein übergeordneter wissenschaftlicher Ansatz, der diese Fragen zufriedenstellend beantworten und eine umfassende Analyse von Bildungsungerechtigkeiten in Schulen und Hochschulen leisten kann. Der Sonderforschungsbereich „Inclusion : Recognition : Justice. Teilnahme und Teilhabe im Prozess des Aufwachsens“ will ein Konzept entwickeln, das die Bildungsungleichheit in Deutschland betrachtet und mit Daten aus dem Ausland vergleicht. Dabei sollen theoretische und empirische Forschung kombiniert werden, um ein ganzheitliches Verständnis von Bildungsungerechtigkeit zu gewinnen. (Universität Frankfurt/Main, Sprecherin: Professorin Dr. Merle Hummrich)
Welche Rolle spielen Stille und Rauschen im Sprachgebrauch? In der Alltagskommunikation kommt es immer wieder zu verschiedenen Formen von Stille (ausgelassene Satzteile, unausgesprochene Gedanken) oder verrauschten Signalen (ungewohnte Aussprache in Dialekten, Gespräche in lauten Restaurants). Menschen sind trotzdem mühelos in der Lage, sprachliche Regelverstöße zu ignorieren, irrelevante Artikulationsmerkmale auszublenden und regelwidrige Muster als Teil von Sprachspielen oder Sprachwandel neu zu deuten. Bislang wurde in der Linguistik jedoch noch nicht versucht, Stille und Rauschen in ihren verschiedenen Facetten in einem ganzheitlichen Ansatz zu untersuchen. Dies will der SFB „Zu Stille und Rauschen im sprachlichen Signal“ ändern und mit seinen Arbeiten die bestehenden linguistischen Theorien erweitern. (Universität Konstanz, Sprecherin: Professorin Dr. Miriam Butt)
Wie Zellen auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren und die zughörigen Reize, sogenannte Trigger, verarbeiten, will der SFB „Chemische und Biologische Prinzipien zellulärer Trigger-Antworten“ systematisch untersuchen. Mit dem bisher in der Forschung angewendeten Methodenspektrum war es bislang nicht möglich, Trigger in der komplexen Umgebung einer Zelle zu untersuchen, sodass ein detailliertes Verständnis dafür fehlt, wie Zellen Trigger wahrnehmen und mit welchen Prozessen sie darauf reagieren. Der Verbund will dem mit einem umfassenden Ansatz begegnen und bakterielle wie eukaryontische Zellen sowie bisher wenig untersuchte chemische und physikalische Trigger miteinbeziehen. (Universität Konstanz, Sprecherin: Professorin Dr. Erika Isono)
Desmosomen sind molekulare Strukturen, die Verbindungen zwischen Zellen herstellen. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass Störungen in diesen Strukturen zur Entstehung entzündlicher Erkrankungen in menschlichen Epithelorganen beitragen. So wird etwa Pemphigus vulgaris durch Autoantikörper gegen Desmosomen verursacht und äußert sich in schwerer Blasenbildung der Haut. Der SFB/Transregio „Desmosomale Dysfunktion epithelialer Barrieren (DEFINE)“ will zentrale Mechanismen von Funktionsstörungen in Desmosomen anhand unterschiedlicher Erkrankungen in den Organsystemen Haut und Verdauungstrakt untersuchen. Der vergleichende Blick auf verschiedene Krankheitsbilder soll gleichzeitig übergreifende Erkenntnisse zu grundlegenden Funktionen von Desmosomen ermöglichen. (Universität Marburg, Sprecher: Professor Dr. Michael Hertl; ebenfalls antragstellend: LMU München, Universität Würzburg)
Der SFB „Kompartimentierte Zelluläre Netzwerke bei Neurovaskulären Erkrankungen“ beschäftigt sich mit neurovaskulären Erkrankungen (NVDs), die weltweit zu den häufigsten Todesursachen sowie Auslösern für Behinderungen zählen. Jedoch gibt es bislang nur wenige verfügbare Therapiemöglichkeiten, auch, weil die zugrunde liegenden Mechanismen von NVDs noch immer nicht ausreichend verstanden sind. Der Verbund will daher erforschen, wie die zellulären und molekularen Prozesse ablaufen, die den Verlauf und die Komplikationen der Erkrankungen bestimmen. Grundlage ist dabei die Hypothese, dass diese Prozesse nicht isoliert, sondern durch hochgradig koordinierte Interaktionen in kompartimentierten Netzwerken aus Gefäß-, Immun- und Gliazellen gesteuert werden. (LMU München, Sprecher: Professor Dr. Martin Dichgans)
Weltweit sind rund 50 Millionen Paare von Unfruchtbarkeit (Infertilität) betroffen – ungefähr die Hälfte davon aufgrund der Infertilität des Mannes. Nichtsdestotrotz wurde bisher vor allem die weibliche Unfruchtbarkeit erforscht, weswegen der Pathomechanismus für die Infertilität beim Mann noch nicht ausreichend verstanden ist. An dieser Stelle setzt der SFB „Reproduction.MS – Molekulare Pathomechanismen männlicher Infertilität“ an und will die Infertilität von Männern eingehender untersuchen. Die Erkenntnisse sollen für bessere Behandlungsmöglichkeiten genutzt werden und damit auch die Situation der Frauen verbessern, denn sie tragen bislang die meisten Risiken und Lasten bei der Behandlung der Fertilitätsstörungen. (Universität Münster, Sprecher: Professor Dr. Frank Tüttelmann)
„Bor als eigenschaftsbestimmendes Element“ steht im Zentrum des gleichnamigen SFB. Molekulare Bor-Chemie soll darin zu einer vielseitigen Plattform für ein breites Anwendungsspektrum etabliert werden – im Kontext von Feinchemikalien, Wirkstoffen und funktionalen Materialien, in denen das Bor-Atom die Eigenschaften im Wesentlichen oder im Zusammenspiel mit anderen Bausteinen bestimmt. Dabei will der Verbund sowohl neuartige Bor-zentrierte Synthese- und Katalysestrategien sowie Verbindungsklassen erforschen als auch Bor-basierte Funktionsmaterialien beispielsweise in der Batterietechnik, Sensorik und für optoelektronische Komponenten entwickeln. Weitere Bor-Verbindungen sollen für den Einsatz als Fluoreszenzmarker oder Krebstherapeutika weiterentwickelt werden. (Universität Würzburg, Sprecher: Professor Dr. Maik Finze)
Die für eine weitere Förderperiode verlängerten Sonderforschungsbereiche
(in alphabetischer Reihenfolge ihrer Sprecherhochschulen, unter Nennung der Sprecher*innen sowie der weiteren antragstellenden Hochschulen und mit Verweisen auf die Projektbeschreibungen in der DFG-Internetdatenbank GEPRIS zur laufenden Förderung):
- TRR „Mechanismen kardiovaskulärer Komplikationen bei chronischer Niereninsuffizienz“ (RWTH Aachen, Sprecher:Professor Dr. Joachim Jankowski; ebenfalls antragstellend: Universität des Saarlandes), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32290093(externer Link)
- TRR „Ultraschnelle Spindynamik“ (FU Berlin; Sprecher: Professor Dr. Martin Weinelt; ebenfalls antragstellend: Universität Halle), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32854548(externer Link)
- SFB „Re-Figuration von Räumen“ (TU Berlin, Sprecherin: Professorin Dr. Martina Löw), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/29004524(externer Link)
- TRR „Stark wechselwirkende Materie unter extremen Bedingungen“ (Universität Bielefeld, Sprecher: Professor Dr. Sören Schlichting; ebenfalls antragstellend: TU Darmstadt, Universität Frankfurt/Main), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31547758(externer Link)
- SFB „Extinktionslernen“ (Universität Bochum, Sprecher: Professor Dr. Onur Güntürkün), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31680338(externer Link)
- SFB „Transiente Atmosphärendruckplasmen – vom Plasma zu Flüssigkeiten zu Festkörpern“ (Universität Bochum; Sprecher: Professor Dr. Achim von Keudell), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32788631(externer Link)
- TRR „Zukunft im ländlichen Afrika: Zukunft-Machen und sozial-ökologische Transformation“ (Universität Bonn, Sprecherin ab 1.1.2026: Professorin Dr. Britta Klagge; ebenfalls antragstellend: Universität Köln), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32896676(externer Link)
- TRR „Ökonomische Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen: Chancengleichheit, Marktregulierung und Finanzmarktstabilität“ (Universität Bonn, Sprecher ab 1.1.2026: Professor Dr. Sven Rady; ebenfalls antragstellend: Universität Mannheim), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32673137(externer Link)
- SFB „Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik“ (Universität Bremen, Sprecher ab 1.1.2026: Professor Dr. Markus Tepe), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/37466684(externer Link)
- TRR „Die Nebenniere: Zentrales Relais in Gesundheit und Krankheit“ (TU Dresden, Sprecher: Professor Dr. Stefan R. Bornstein; ebenfalls antragstellend: LMU München, Universität Würzburg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31406127(externer Link)
- TRR „Geometrie und Arithmetik uniformisierter Strukturen (GAUS)“ (Universität Frankfurt/Main, Sprecher: Professor Dr. Jakob Stix; ebenfalls antragstellend: TU Darmstadt, Universität Heidelberg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/44484512(externer Link)
- SFB „Onkogen-getriebener Immun Escape (OncoEscape)“ (Universität Freiburg, Sprecher: Professor Dr. Robert Zeiser), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/44189134(externer Link)
- SFB „Quantitative Synaptologie“ (Universität Göttingen, Sprecher: Professor Silvio-Olivier Rizzoli Ph.D.), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31747586(externer Link)
- TRR „Sicherheitsintegrierte und infektionsreaktive Implantate“ (MHH Hannover, Sprecherin: Professorin Dr. Meike Stiesch; ebenfalls antragstellend: Universität Hannover), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/42633575(externer Link)
- SFB „Mechanismen und Funktionen des Wnt-Signalwegs“ (Universität Heidelberg, Sprecher: Professor Dr. Michael Boutros), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/33135171(externer Link)
- SFB „Extremes Licht zur Analyse und Kontrolle molekularer Chiralität (ELCH)“ (Universität Kassel, Sprecher: Professor Dr. Arno Ehresmann), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32896111(externer Link)
- SFB „Vorhersagbarkeit in der Evolution“ (Universität Köln, Sprecher: Professor Dr. Michael Lässig), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32593197(externer Link)
- SFB „Gezielte Beeinflussung von konvergierenden Mechanismen ineffizienter Immunität bei Tumorerkrankungen und chronischen Infektionen“ (Universität Mainz, Sprecher ab 1.1.2026: Professor Dr. Tobias Bopp), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31834649(externer Link)
- SFB „Humandifferenzierung (Studies in Human Differentiation)“ (Universität Mainz, Sprecher: Professor Dr. Stefan Hirschauer), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/44226129(externer Link)
- TRR „RMaP: RNA Modifikation und Prozessierung“ (Universität Mainz, Sprecher: Professor Dr. Mark Helm, ebenfalls antragstellend: Universität Heidelberg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/43966944(externer Link)
- TRR „Die Tropopausenregion in einer Atmosphäre im Wandel“ (Universität Mainz, Sprecher: Professor Dr. Peter Hoor; ebenfalls antragstellend: Universität Frankfurt/Main), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/42831274(externer Link)
- TRR „LETSIMMUN – Lymphozyten Engineering für Therapeutische Synthetische Immunität“ (TU München, Sprecher: Professor Dr. Dirk Busch; ebenfalls antragstellend: LMU München, Universität Würzburg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/45288190(externer Link)
- SFB „Dynamische zelluläre Grenzflächen: Bildung und Funktion“ (Universität Münster, Sprecher: Professor Dr. Stefan Luschnig), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/38679783(externer Link)
- TRR „Erklärbarkeit konstruieren“ (Universität Paderborn, Sprecherin: Professorin Dr. Katharina Rohlfing; ebenfalls antragstellend: Universität Bielefeld), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/43844582(externer Link)
- SFB „Datenassimilation – Die nahtlose Verschmelzung von Daten und Modellen“ (Universität Potsdam, Sprecherin: Professorin Dr. Melina Freitag), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31876390(externer Link)
- SFB „Die Grenzen der Variabilität in der Sprache: Kognitive, komputationale und grammatische Aspekte“ (Universität Potsdam, Sprecherin: Professorin Dr. Doreen Georgi), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31763348(externer Link)
- SFB „Emergente relativistische Effekte in der Kondensierten Materie: Von grundlegenden Aspekten zu elektronischer Funktionalität“
(Universität Regensburg, Sprecher: Professor Dr. Jaroslav Fabian), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/31469503(externer Link) - TRR „Steuerung der Transplantat-gegen-Wirt- und Transplantat-gegen-Leukämie-Immunreaktionen nach allogener Stammzelltransplantation“ (Universität Regensburg, Sprecher: Professor Dr. Wolfgang Herr; ebenfalls antragstellend: Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Würzburg), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32439263(externer Link)
- TRR „Kontrolle der chemischen Photokatalyse durch Molekülverbände“ (Universität Regensburg, Sprecher ab 1.1.2026: Professor Dr. Burkhard König; ebenfalls antragstellend: TU München), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/44463263(externer Link)
- SFB „ELektrisch Aktive ImplaNtatE – ELAINE“ (Universität Rostock, Sprecher ab 1.1.2026: Professor Dr.-Ing. Sascha Spors), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/29915058(externer Link)
- SFB „Grenzflächenbeeinflusste Mehrfeldprozesse in porösen Medien – Strömung, Transport und Deformation“ (Universität Stuttgart, Sprecher: Professor Dr.-Ing. Holger Steeb), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32715436(externer Link)
- TRR „Von den Grundlagen der Biofabrikation zu funktionalen Gewebemodellen“ (Universität Würzburg, Sprecher: Professor Dr. Jürgen Groll; ebenfalls antragstellend: Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Bayreuth), https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/32699813(externer Link)
Transferprojekte für bereits in der Förderung befindliche Sonderforschungsbereiche:
Für zwei SFB hat der Bewilligungsausschuss zudem je sechs Transferprojekte bewilligt. Die Projekte werden mit insgesamt rund 5 Millionen Euro gefördert. Die in allen bewilligten Projekten beteiligten Anwendungspartner kommen aus einer Vielzahl verschiedener Branchen (u.a. Automobilbau, Maschinenbau, Prüftechnik) und unterstützen die Forscher*innen mit eigenen Mitteln. Die in den Transferprojekten gewonnenen Erkenntnisse sollen in die jeweiligen Verbünde zurückfließen und bereichern somit auch die dortige Grundlagenforschung.
Die Transferprojekte des seit 2014 geförderten SFB „Bauteilpräzision durch Beherrschung von Schmelze und Erstarrung in Produktionsprozessen“ (RWTH Aachen, Sprecher: Professor Dr. Uwe Reisgen) befassen sich beispielsweise mit der Vermeidung spannungsinduzierter Risse beim Laserstrahl-Mikroschweißen, einer KI-optimierten Bahnplanung für Laserschweißprozesse oder der Integration neuronaler Netze in Gießsimulationen.
Die Transferprojekte des seit 2019 geförderten SFB/Transregio „Methodenentwicklung zur mechanischen Fügbarkeit in wandlungsfähigen Prozessketten“ (Universität Paderborn, Sprecher: Professor Dr. Gerson Meschut; ebenfalls antragstellend: TU Dresden, Universität Erlangen-Nürnberg) sollen unter anderem die Reibmodellierung mechanischer Füge- und Umformverfahren bei industriellen Fertigungseinflüssen und die Festigkeitssteigerung beim Fügen faserverstärkter Kunststoffe in die Anwendung transferieren.
Weiterführende Informationen
Ausführliche Informationen zum Förderprogramm und zu den geförderten Sonderforschungsbereichen unter: www.dfg.de/sf(interner Link)
Weitere Informationen erteilen auch die Sprecher*innen der Sonderforschungsbereiche.
Kontakt
| E-Mail: | presse@dfg.de |
| Telefon: | +49 228 885-2109 |
| E-Mail: | Suzanne.Zittartz-Weber@dfg.de |
| Telefon: | +49 (228) 885-2304 |