„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch

Miriam Fichtner
© Privat
(10.05.21) Die Medizinerin und Neurowissenschaftlerin Miriam Fichtner ist seit Februar 2018 als Postdoc am Department of Neurology and Immunobiology der Yale University in New Haven, CT und wird dort seit Herbst 2019 durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Sie gewinnt in der Gruppe von Kevin O’Connor neue Einblicke in die autoimmunen Mechanismen der Nervenkrankheit Myasthenia gravis und sprach mit dem Nordamerika-Büro der DFG unter anderem über ihr derzeitiges Forschungsprojekt, ihre beruflichen Ziele, die Vorhand von Rafael Nadal, Bieressig und über Elisabeth von Österreich-Ungarn, bekannt als „Sisi“.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium und seit 2019 mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen, Ausdruck einer vor allem in den Lebenswissenschaften immer noch herrschenden Überzeugung, dass hilfreich für die Karriere sei, „in Amerika gewesen“ zu sein. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer FI 2471 verbirgt.
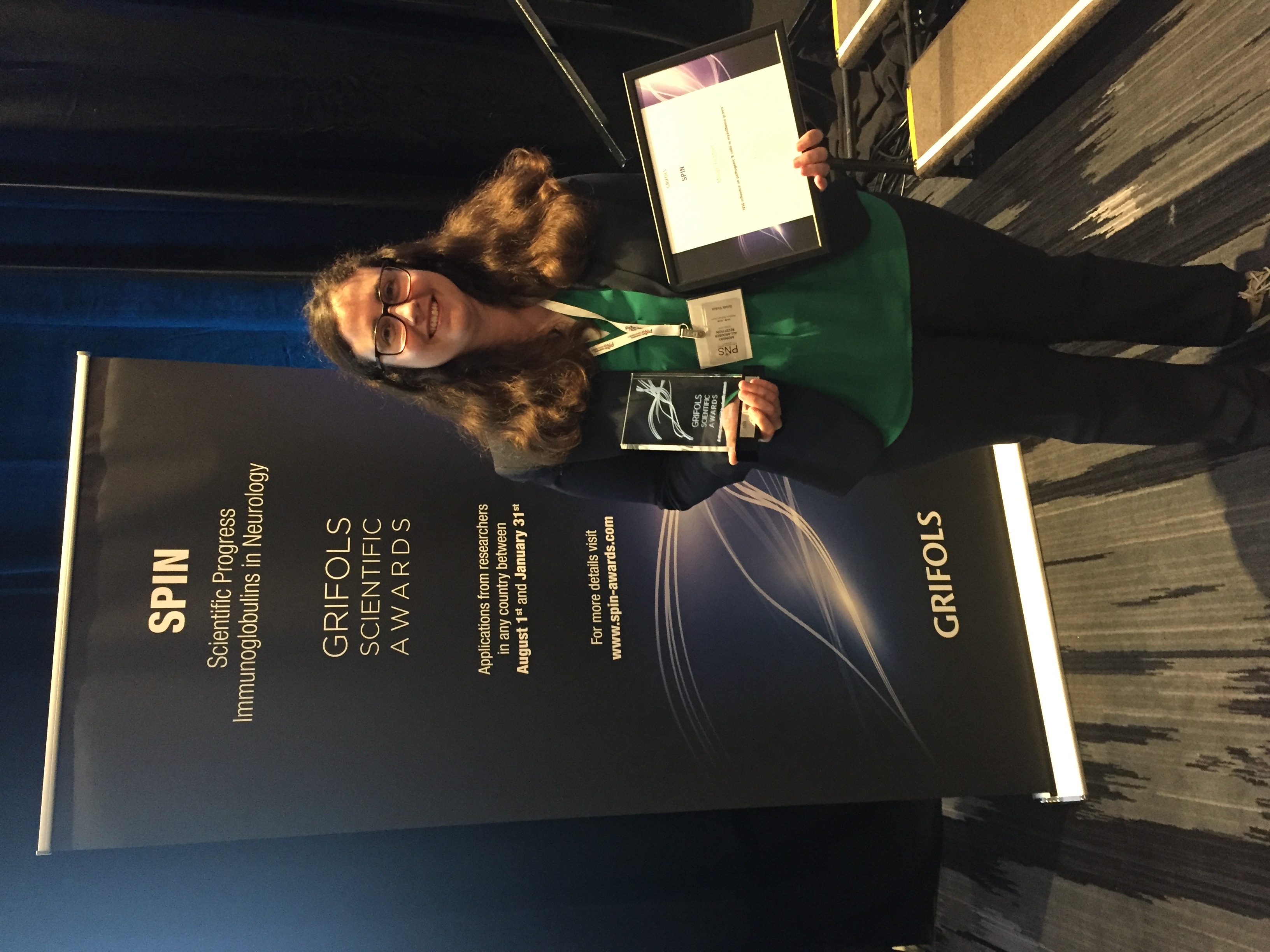
Miriam Fichtner bei der Verleihung des SPIN-Preises
© Privat
DFG: Liebe Frau Dr. Fichtner, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Mit einer Abiturnote knapp unter der Bestmarke „mussten“ Sie wohl Medizin studieren, oder?
Miriam Fichtner (MF): Besten Dank für die Gesprächsmöglichkeit und auch ein herzliches Dankeschön an die DFG für ein Stipendium, das mir hier an Yale für mein Forschungsprojekt gewissermaßen den Rücken freihält. Zu Ihrer Frage: Es hätte auch Mathematik oder Physik sein können. In der Oberstufe hatte ich Mathematik und Physik als meine beiden Leistungskurse und mit Herrn Grün einen sehr begeisternden Lehrer.
DFG: War Herr Grün einer ihrer Vorbilder?
MF: Ja, das kann man so sagen. Herr Grün war ein echt guter Lehrer und ich hatte ihn zwei Jahre als Physiklehrer in der Oberstufe. Ebenso wäre da meine Latein- und Religionslehrerin Frau Dr. Elbl hervorzuheben. Sie hat mich immer zum Denken angestoßen und ihren Unterricht sehr vielfältig gestaltet. Auch meine Eltern sind Vorbilder. Mein Vater arbeitet als Physiker im Landesamt für Umwelt in Augsburg und ich bewundere vor allem seine Genauigkeit und sein Durchhaltevermögen. Er hat zum Beispiel erst mit Mitte vierzig begonnen Tennis zu spielen und hat sich zielstrebig so sehr verbessert, dass er zeitweise sogar in der Bayernliga gespielt und mit seiner Mannschaft 2019 den Titel Mannschaft des Jahres in unserer Region erhalten hat. Wissenschaftlich konnte er mich als kleines Kind mit Dingen wie einem absolut schalltoten Raum in seiner Arbeit schon ziemlich beeindrucken. Meine ältere Schwester war in allen Dingen immer der Vorreiter und das Vorbild, dem ich nachgeeifert habe. Meine Mutter ist eine sehr wissbegierige und aufgeschlossene Person. Sie ist vielseitig interessiert und hat sich über die Jahre sehr viel Wissen angelesen. Neben meiner Mutter müsste ich noch ihren Vater nennen, der mir als Revierförster sehr viel Liebe zur Natur, ein gehöriges Maß an Neugier und Pflichtbewusstsein vermittelt hat. Meine frühesten Versuche befassten sich mit lebenserhaltenden Maßnahmen an unseren Christbäumen, die ich oft bis in den April hinein in Wasser hielt, um zu schauen, wie lange ich sie grün halten kann. Einige der Bäume trieben tatsächlich nach einiger Zeit an den Zweigen etwas aus, aber ein richtiger Erfolg wurde es nicht. Allerdings mochte unsere Katze dieses Wasser gerne trinken und sie ist immerhin 22 Jahre alt geworden. Etwas systematischer bin ich dann als Kind schon an die Untersuchung von Gärungsprozessen herangegangen, denen ich eher zufällig bei einem vergessenen Glas Holundersaft begegnet war. Meine Eltern haben vor Beendigung des Versuches die Versuchsreihe entdeckt und ich musste versprechen, aus den Versuchsprodukten keinen Schnaps zu brennen.
DFG: Da sind wir aber noch nicht bei Medizin.
MF: Als mein Großvater plötzlich starb, wurde das „wissen wollen“ durch ein „helfen wollen“ erst einmal in den Schatten gestellt. Ich belegte an der Schule einen Sanitäter-Kurs und wollte Notfallmedizinerin werden. Während des Studiums in München habe ich dann die Forschung sozusagen wiederentdeckt. Mein Interesse richtete sich dabei auf Neurologie und Immunologie. Im Rahmen meiner Doktorarbeit im Labor von Professor Edgar Meinl am Institut für Klinische Neuroimmunologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) wurde mir klar, dass ich nach dem Studium weiterhin im Bereich der translationalen Forschung arbeiten und meinen Schwerpunkt auf die Erforschung von Myasthenia gravis legen will.
DFG: Myasthenia gravis ist nur Fachleuten ein Begriff.
MF: Ja, und den wenigen Patienten, die davon betroffen sind. Es ist eine vergleichsweise seltene Autoimmunerkrankung, die durch Störungen der Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskel im Extremfall tödlich sein kann. Ich bin mit ihr am Friedrich-Bauer-Institut der LMU in Berührung gekommen und sie fasziniert mich, weil man schon recht gut weiß, gegen welche Strukturen die Immunantwort gerichtet ist. Wie sie entsteht, also die Immunopathogenese, ist bei weitem noch nicht so aufgeklärt. Daran arbeiten wir derzeit und erhoffen uns von diesen Erkenntnissen auch ein verbessertes allgemeines Verständnis von Autoimmunerkrankungen.
DFG: Warum ist es dafür wichtig, in den USA zu sein, insbesondere im Labor von Kevin O’Connor?
MF: Am Department of Neurology and Immunobiology der Yale University gibt es die vermutlich größte Sammlung von Zellmaterial zum Thema und entsprechend mit David Halfer und Joseph Craft zwei Koryphäen in den Bereichen Neurologie bzw. Immunologie. In diesem Umfeld ist das Labor von Kevin O’Connor natürlich eine der weltbesten Adressen für mein Feld, nicht nur für mich aus Deutschland, sondern auch für andere internationale Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler.
DFG: Wie soll es denn mit Ihrer Karriere weitergehen?
MF: Ich werde noch fast ein Jahr von der DFG unterstützt, was meinem Standing, meiner Eigenständigkeit im Labor sehr zuträglich ist. Die Forschung läuft hervorragend und die notwendigen Publikationen zum Beleg eines deutlich überdurchschnittlichen „Track Records“ sind in Vorbereitung bzw. bereits auf gutem Weg oder veröffentlicht. Ich würde mich daher in den kommenden Monaten um eine Stelle als Nachwuchsgruppenleiterin bewerben wollen und habe auch bereits Anfragen aus Deutschland, ob ich nicht dort meine Karriere fortsetzen wollte. Es wird aller Voraussicht nach also in Deutschland und auf einem der vielversprechenden Pfade für den talentiertesten wissenschaftlichen Nachwuchs weitergehen. Ich behalte dabei aber immer die Worte eines Ihnen sicherlich auch bekannten Augsburgers aus seiner „Ballade von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens“ im Kopf.

Miriam Fichtner mit ihrer Mutter an Yale in New Haven
© Privat
DFG: Aber bislang lief doch alles nach Plan?
MF: Nicht alles. Als ich nach Yale ging, begleitete mich in den ersten paar Tagen meine Mutter. Wir hatten uns vorher informiert, dass Yale in einer netten Hafenstadt namens New Haven liegen würde. Das war nur zum Teil richtig, die Stadt heißt wirklich so. Als wir aber auf der Suche nach einem hübschen Café mit Meeresblick alles, wirklich alles andere entdeckt haben, als ein hübsches Café mit Meeresblick, wollte mich meine Mutter am liebsten gleich wieder mit zurück nach Aichach nehmen. Sie macht sich vermutlich immer noch mehr Sorgen um mein Wohlbefinden als um meine wissenschaftliche Karriere.
DFG: Sie wollen künftig neben der Forschung auch Forschung organisieren, betreuen und lehren. Haben Sie da schon Erfahrungen sammeln können?
MF: Ja, denn es ist in den Labors üblich, dass Postdocs Postgraduierte und andere Studenten anleiten und deren Ergebnisse strukturieren und aufbereiten. Des Weiteren mache ich seit diesem Jahr Mentoring für benachteiligte Studenten. Ich habe derzeit eine sehr talentierte Frau als Mentee, die Medizin studieren will. Im Grunde ist es meine wichtigste Aufgabe, ihr gelegentlich das Selbstbewusstsein zu stärken und sie aufzubauen. Es ist schwieriger den Weg ins Medizinstudium zu finden, wenn man als Erste aus der Familie und deren Umkreis diesen Weg geht. Unter den Scheffel gestelltes Licht sieht man in Deutschland vor allem bei Frauen, hierzulande bei Frauen und Minoritäten und umso mehr in der Kombination von beidem. Da lässt sich mit wenig Eingriff schon enorm was bewirken.
DFG: Sie erwähnen in Ihrem Lebenslauf auch eine andere Karriere, nämlich die als Tennisspielerin.
MF: Da müssen Sie „Karriere“ aber eher wertneutral verstehen, denn wirklich super bin ich in dieser Disziplin nicht. Ich bin auf etwas verschlungenen Wegen von Karate über Fußball zum Tennis gekommen und hatte daher zunächst erhebliche Probleme mit der Länge meiner Vorhandschläge. In einem Tennis-Magazin bin ich dann irgendwann mal über die Spin-Technik von Rafael Nadal gestolpert, habe das eine ganze Weile trainiert und hatte dann – sobald ich meine Rückhand umlaufen konnte – neben dem „Slice“ auch einen richtigen „Winner“ im Repertoire. Damit kommen Sie auf Bezirksliga-Niveau ziemlich weit und für mich hat es sogar zur Club-Meisterschaft gereicht. Es geht allerdings enorm auf Kosten des Handgelenks, ist also nicht nachhaltig und darum habe ich inzwischen meine Tennis-Ambitionen deutlich zurückgefahren.
DFG: Sie waren zusammen mit ihrer Mutter in der lokalen Hörfunkreihe „Aichach am Ohr“ tätig und haben an einem Vortrag über die Essiggasse in Aichach mitgewirkt.
MF: Der Ruhm gebührt meiner Mutter. Sie ist als Heimatexpertin sehr aktiv und hat schon zweimal an dieser Reihe mitgewirkt. Für das Projekt mit der Essiggasse war sie monatelang im Archiv von Aichach. Sie hat nach Erwähnungen der Essiggasse gesucht und daraus dann dieses Projekt entwickelt. Zufälligerweise ist sie dabei auf Bieressig gestoßen. Der entsteht bzw. entstand in Zeiten vor modernen Konservierungstechniken, wenn das Bier sauer wurde und es nicht mehr als Bier verkauft werden konnte. Sie hat dann eigene Versuche der Herstellung von Bieressig durchgeführt, musste dazu aber erst einmal einen Brauer finden, dessen Bier überhaupt noch sauer werden konnte. Es hat sich aber gelohnt, denn der von ihr hergestellte Bieressig ist nun zentraler Bestandteil von hausgemachtem Biersenf und der wiederum gibt zahlreichen regionalen Rezepten den entscheidenden Kick. Insofern war dann auch die ganze Familie Nutznießer dieser Aktion gewesen, die von meiner Mutter als eine Art wissenschaftliches Zwiegespräch mit mir als Sprecherin gestaltet wurde.
DFG: Zum Abschluss noch eine Frage: Sie sind in Aichach unweit des Wasserschlosses Unterwittelsbach groß geworden. Könnten Sie aus dem Stehgreif eine Führung durch den Gebäudekomplex geben, der vor allem als „Sisi-Schloss“ bekannt ist, und wenn ja, was wären da die Highlights?
MF: Da wäre ebenfalls meine Mutter eigentlich die Expertin. Sie ist enorm interessiert und bewandert, was die lokale Geschichte angeht. Aber natürlich färbt so ein Schloss auf die Umgebung ab, bis hin zu einer sicherlich vollständigen Sammlung einschlägiger DVDs bei meiner Großmutter. Würde ich eine Führung geben, dann müsste sie von zwei Dingen handeln. Zum einen gibt es den verbreiteten Mythos „Sisi“, an dem man auch in Aichach teilhaben möchte. Allen mir bekannten Quellen zufolge ist sie nie in Aichach gewesen. Ihrem sehr wohlhabenden Vater, Herzog Max in Bayern, diente es als Jagdschloss. Elisabeth hatte da andere Interessen, nämlich Körperertüchtigung und eine schlanke Taille. Das wäre dann der andere Aspekt, nämlich vor allem jungen Frauen die Gefahren normativer Schönheitsideale vor Augen zu führen.
DFG: Das könnte Ihnen aber Ärger vom Hersteller der Barbie-Puppen eintragen. Herzlichen Dank für das unterhaltsame Gespräch. Dann wünschen wir Ihnen in den kommenden Monaten noch einen sicheren und vor allem ertragreichen Aufenthalt in New Haven und weiterhin viel Erfolg in Ihrer wissenschaftlichen Karriere.