„In Amerika gewesen“: Deutsche Forschende in den USA und Kanada im Gespräch
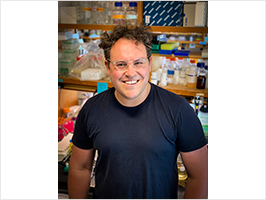
Dr. Julian Grünewald
© DFG
(30.09.20) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen, Ausdruck einer, vor allem in den Lebenswissenschaften immer noch herrschenden Überzeugung, für die Karriere „in Amerika gewesen“ sein zu müssen.
Anlässlich der Jahrestagungen des German Academic International Network (GAIN) organisiert das DFG Nordamerika-Büro seit einigen Jahren ein Treffen der DFG-Geförderten, um Erfahrungen auszutauschen, untereinander und vor allem auch mit ihrer Förderorganisation. In diesen Gesprächen bekommen wir aktuelle Eindrücke von den Lebens- und Arbeitsbedingungen des deutschen wissenschaftlichen Nachwuchses in Nordamerika, selbst wenn – wie in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 die Jahrestagung Ende August virtuell stattgefunden hat. Wir möchten Ihnen in einer Reihe von Interviews aktuelle DFG-Geförderte vorstellen und Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wer sich zum Beispiel hinter der DFG-Fördernummer GR 5129 verbirgt.
DFG: Lieber Herr Dr. Grünewald, herzlichen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft.
Sie werden bei der DFG als GR 5129 geführt und haben beim Betreten des nordamerikanischen Kontinents den Umlaut in der Schreibung Ihres Nachnamens abgeben müssen. Kurz: Das Leben als Wissenschaftler ist nicht immer leicht. Hatten Sie nicht auch andere, vielleicht sogar zwingende Talente, also überdurchschnittlich gutes Klavier- oder Fußballspiel, und wenn ja, was gab dann den Ausschlag für die Wissenschaft?
Julian Grünewald (JG): Ich spiele zwar Klavier, aber bei weitem nicht gut genug, um daraus einen Beruf zu machen. Meinem Klavierlehrer bin ich jedoch dankbar, dass er irgendwann bei mir von Bach auf Improvisationslehre umschwenkte, das hat mich sicher auch auf eine experimentelle Laufbahn vorbereitet. Fußball war nie meine Stärke, dann schon eher Sprachen und Literatur. Den Weg zur Wissenschaft fand ich über die Medizin, die für mich ein Schmelztiegel von Wissenschaft, Gesellschaft und Ethik ist. Die Initialzündung für eine Karriere als forschender Arzt war letztlich meine Doktorarbeit an der Uniklinik Freiburg zum Thema Zellmigration. In den Laboren der Nephrologie von Professor Matias Simons und Professor Gerd Walz wurde die Kombination von Grundlagenforschung und Medizin vorgelebt und mit Enthusiasmus gefördert.
DFG: In Ihrem CV steht: „Abitur am Stefan-George-Gymnasium in Bingen am Rhein, Note: 1,0.“ Mussten Sie da nicht Medizin studieren oder wenigstens Zahnmedizin? Was sind denn Ihre Eltern von Beruf?
JG: Ich denke, schlicht wegen einer guten Abiturnote Medizin zu studieren wäre der falsche Impuls. Mein Vater ist Architekt, meine Mutter Gynäkologin. Klar, so ein Elternhaus könnte man schon als eine Mischung aus angewandter Kunst und angewandten Naturwissenschaften beschreiben- und mich als logisches Ergebnis. Ich bin mir den glücklichen und privilegierten Umständen sehr bewusst.
DFG: Lassen Sie uns über Ihre Karriere sprechen. Sie sind, wenn Sie mir das Bild gestatten, mit einem Booster der DFG, dem Forschungsstipendium, ausgestattet worden, um Ihre wissenschaftliche Karriere als Postdoc in den USA weiter zu beschleunigen. Sie haben mittlerweile ordentlich zu CRISPR Geneditierungswerkzeugen publiziert, zum Teil sogar als Erstautor in Nature und Nature Biotechnology. Wo soll die Reise hingehen, Professur, Direktor an einem Max-Planck-Institut?
JG: Danke, aber der Plan ist jetzt zunächst, den Postdoc hier ordentlich abzuschließen und sich gleichzeitig um die Rückkehr nach Europa zu kümmern. Das Ziel ist immer noch ein forschender Arzt mit eigener Arbeitsgruppe zu werden. Dabei möchte ich CRISPR gene editing und kardiovaskuläre Forschung kombinieren, mit dem Ziel, Krankheiten genetisch zu modellieren. Und um mittel- und langfristig neue Gen- und Zelltherapien zu entwickeln. Dieser nächste Karriereschritt wird mit Sicherheit eine willkommene Herausforderung. Ich fände es toll, wenn seitens der DFG für solche Aspekte – oder auch ganz allgemein für alle Geförderten – eine persönliche Mentorin oder einen Mentor zur Seite gestellt würde. Am besten jemanden, die oder der mit einem ähnlichen Karriereweg vertraut ist.
DFG: Wo sehen Sie sich in 15 Jahren?
JG: Mein Ziel ist es, mit anderen Forscherinnen und Forschern und Ärztinnen und Ärzten das Feld der Zell- und Gentherapie in Europa voranzutreiben und junge Forscherinnen und Forscher dafür zu begeistern. Was dann für ein Titel an der Position steht, ist für mich sekundär. Klar, eine exzellente Grundausstattung ist wichtig, oder als Max Planck-Direktor weniger Zeit auf Förderanträge verwenden zu müssen- doch das ist nicht mein primäres Ziel. Was ich in Boston gelernt habe, ist, dass extremer wissenschaftlicher Enthusiasmus, Offenheit, sowie ein hochdynamisches und – in jeder Hinsicht – diverses Umfeld zum Erfolg führen. Wo immer so eine Konstellation in der EU besteht, da möchte ich hin!
DFG: Sie arbeiten im Labor von Professor Keith Joung am Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School. Was hat Sie dorthin verschlagen?
JG: Prof. Joung hat eine der weltweit führenden Gruppen zur Entwicklung und Optimierung von Werkzeugen des sogenannten „Gene Editing”. Hierzu gehören Zinkfinger-Nukleasen und die CRISPR-Technologie, sowie deren neuere Iterationen, das Base und Prime Editing. Das Joung Lab bildet gemeinsam mit den Gruppen von Jennifer Doudna, David Liu und Jonathan Weissman das von den National Institutes of Health (NIH) geförderte Center for Genome Editing and Recording (CGER). Diese vier Labore gehören zur weltweiten Spitzengruppe bei der Weiterentwicklung von CRISPR-Technologien, die dann beispielsweise in der biologischen Grundlagenforschung, zur Modellierung von Krankheiten, aber auch bereits ansatzweise für Diagnostik und Therapie – also in klinischem Kontext- verwendet werden.
An genau dieser Schnittstelle von Gene Editing und Medizin wollte ich forschen, mit Fokus auf der sicheren Anwendung dieser Technologien. Ich denke, in Zukunft werden wir mehr Ärztinnen und Ärzte brauchen, die Hintergrundwissen zu diesen neuen Therapieformen haben.
DFG: CRISPR-Cas9 hat als „Genschere“ in der breiteren Bevölkerung nicht nur einen guten Ruf und in der Fachwelt ist es zu einem Moratorium für die Anwendung in der menschlichen Keimbahn gekommen. Haben Sie da keine Angst, als „Frankenstein“ zu enden, dass Sie also vom Möglichen überwältigt werden und alle Bedenken über Bord werfen? Anders gefragt: Könnte man mit Gene Editing auch was herstellen, das nicht auch irgendwann einmal durch eine „natürliche“ Mutation entstehen könnte?
JG: Ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst, die mit der Entwicklung dieser Technologien einhergeht. Der von Ihnen angesprochene mutmaßliche Versuch der Geneditierung der menschlichen Keimbahn in 2018 wurde weltweit, zu Recht, scharf verurteilt. Ich befürworte ausdrücklich das von Ihnen angesprochene Moratorium. Ich finde dieser ganze Vorfall bestätigt jedoch auch, dass man in dem Feld eine fundierte medizinische Perspektive benötigt, die die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte mit den wissenschaftlichen integriert und bewerten hilft.
Gleichzeitig möchte ich darauf aufmerksam machen, welche Fortschritte in der somatischen Geneditierung bereits erzielt werden – also eben nicht in der Keimbahn. Hier finden bereits einige klinische Studien statt, die vielversprechende Zwischenergebnisse liefern, zum Beispiel zur Behandlung von genetisch bedingten Anämien.
Ich finde es fundamental wichtig, neue Technologien auch unter ethischen Gesichtspunkten zu bewerten. Manchmal macht mir die Tendenz zur pauschalisierenden Skepsis gegenüber neuen Technologien in Deutschland und Europa im Vergleich zu den USA jedoch auch etwas Sorgen. Ich denke, es ist letztlich auch eine Aufgabe der Wissenschaft, hier besser zu kommunizieren.
DFG: Das beruhigt, lieben Dank. Sie sitzen derzeit wegen COVID-19 im Home-Office. Aber schildern Sie dennoch bitte, was den Alltag in einem Labor wie dem von Keith Joung für Sie so bereichernd macht.
JG: Ich habe in meiner Laufbahn bislang immer sehr den Ortswechsel geschätzt, bin während meines Medizinstudiums in Salamanca, Paris und New York gewesen. Man tickt an verschiedenen Orten jeweils anders, geht verschieden an Probleme heran, ist auf verschiedene Weisen kreativ. Je mehr Diversität, desto mehr kann man beitragen und lernen. Der Alltag in Keith Joungs Labor ist so bereichernd, weil alle extrem motiviert und enthusiastisch sind bezüglich unseres Forschungsfeldes – von der technischen Assistentin oder dem Assistenten, über die Doktorandin oder den Doktoranden, bis hin zu Postdocs mit biologischem, biochemischem oder auch medizinischem Hintergrund. Alle haben viele verschiedene Perspektiven und kulturelle oder auch persönliche Hintergründe, aber das gemeinsame Ziel ist, diese Technologien für wissenschaftliche und medizinische Nutzung mit größtmöglicher Dynamik voranzutreiben. Da wird jeder Treff am - sehr guten - Kaffeeautomaten zu einer kreativen Debatte über neue Ideen und mögliche Versuchsansätze. Und man hilft sich immer gegenseitig – ohne Ausnahme.
DFG: Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Webseiten wie bioRxiv oder medRxiv, wo unterhalb der Ebene von Peer-Review Ideen vorgestellt und diskutiert werden. Verfolgen Sie das?
JG: Klar, die Entwicklung von Preprint-Servern ist sehr zu begrüßen. Andere Felder wie Mathematik und Physik sind da schon deutlich weiter als die Biomedizin. Man muss natürlich, etwa im aktuellen Pandemiegeschehen, darauf hinweisen, dass die Inhalte nur als vorläufig zu bewerten sind. Aber ich bin mir sicher, dass bioRxiv und medRxiv die Biomedizin weiterbringen werden. Auch finde ich die zunehmend fundierte Diskussion von wissenschaftlichen Inhalten auf Twitter sehr interessant. Da findet natürlich auch teilweise eine nicht mehr tragbare Verkürzung statt, wenn man aber auf die Quellen achtet, kann man hier hervorragend von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lernen und sich vernetzen.
DFG: Was wird künftig neben der Wissenschaft für Sie noch wichtig sein?
JG: Die klinische Tätigkeit wird in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen, neben der Wissenschaft.
Ich habe ja bereits fünf Jahre als Assistenzarzt in der Inneren Medizin und Nephrologie der Uniklinik Freiburg gearbeitet bevor ich in den Postdoc gegangen bin. Diese Zeit und den Kontakt zu Patienten vermisse ich außerordentlich. Im Privaten sind mir Familie, Freunde, Musik, Photographie und der Kunstfilm extrem wichtig. Wissenschaftliche Kreativität und der Arztberuf sind für mich persönlich nur in Wechselwirkung mit diesen Einflüssen und Impulsen denkbar.
DFG: Gibt es etwas, auf das Sie derzeit besonders stolz sind und gibt es auf der anderen Seite etwas, das vielleicht nicht so gut, aber dennoch lehrreich war?
JG: Eine außerordentlich begabte technische Assistentin, mit der ich zwei Jahre hier zusammengearbeitet habe, ist kürzlich in der Graduiertenschule von Stanford angenommen worden. Das hat mich extrem gefreut. Die Frage nach Misserfolgen ist natürlich immer relativ einfach zu beantworten als Forscher. Das Wesen von Forschung ist für mich, dass man ständig mit Fehlschlägen und Misserfolgen konfrontiert wird und man dagegen nur mit Teamarbeit, Systematik und Beharrlichkeit ankommen kann. Ich finde, das Lehrreiche dabei ist, wie unfassbar robust Biologie „funktioniert”. Das kann man besser wertschätzen, wenn man weiß wie schwierig es ist, experimentell nur eine einzelne Base eines einzigen Gens in einer einzigen Zelle präzise zu verändern.
DFG: Herzlichen Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen, dass es wie geplant klappen wird, oder besser noch, dass die Überraschungen entlang Ihres Weges überwiegend erfreuliche sein werden.
Kontakt:
- JGRUNEWALD@mgh.harvard.ed
- Twitter @JulesGrunewald